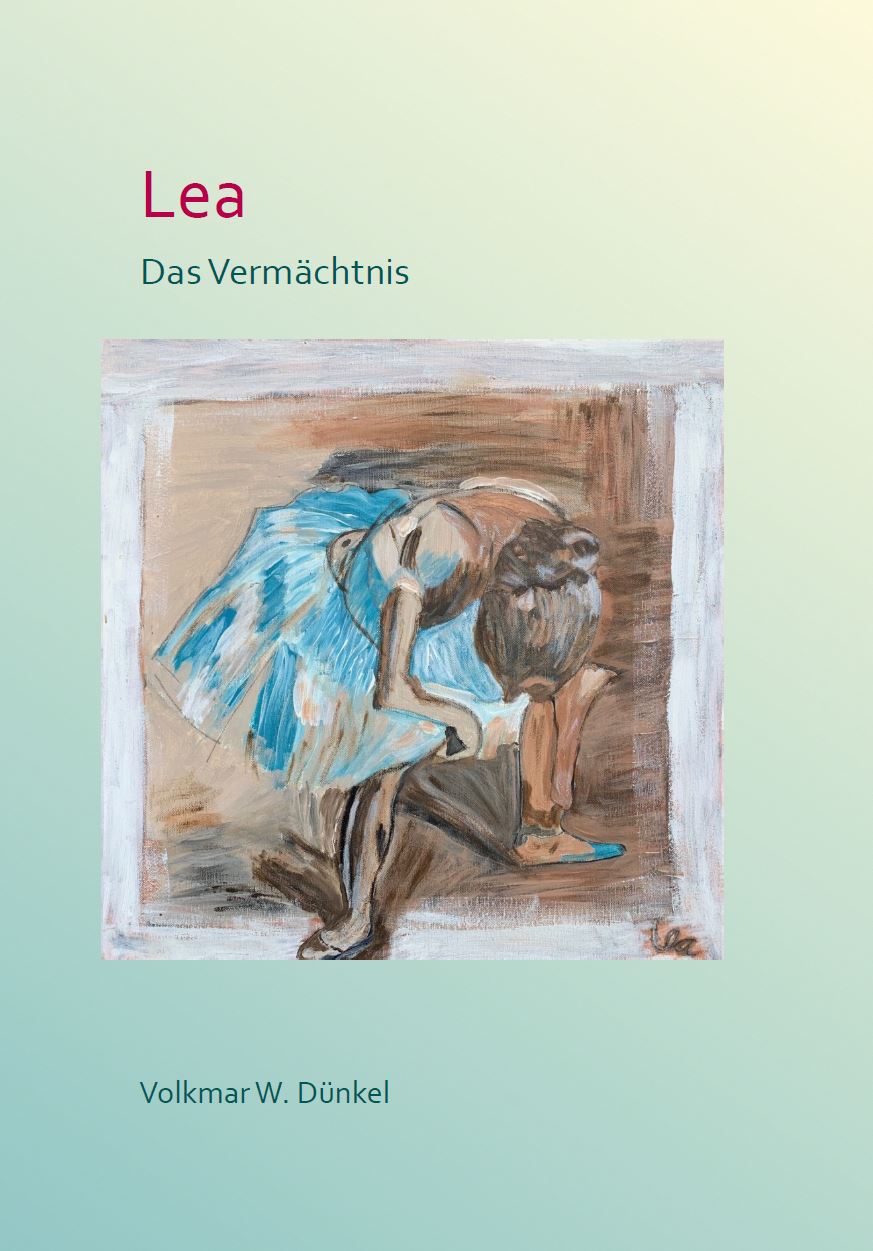Bücher
Lea
Das Vermächtnis
Volkmar W. Dünkel
Gebundene Ausgabe: 168 Seiten
ISBN-10: 3750424799
ISBN-13: 978-3750424791
Lesung
Lea – Das Vermächtnis
am 27.09.2020 in Brietlingen
gelesen von Volkmar W. Dünkel und Elisabeth Dünkel
hier ansehen:
Eine Leseprobe aus dem Buch
Lea
Das Vermächtnis
Prolog
Albtraum
Das Brennen in meinem Körper breitete sich aus wie ein Flächenbrand. Die Gedanken drehten sich im Kopf, einem Brummkreisel gleich, um Hoffnung und Sehnsucht. Immer schneller. Und schneller. Der Boden schwankte unter meinen Füßen, als würde die zornige, hasserfüllte Erde beben. Im Haus verschmierte ich das Treppengeländer und den Aufgang mit blutig aufgeriebenen Händen und Füßen. Oben, kurz vor dem Abgrund in die Tiefe, blieb ich stehen. Mein eisernes Herz glühte und vibrierte nach einem Elektroschock. Ich sehnte das Ende herbei.
Wie einen brennenden Mantel riss ich mir die Bettdecke vom Leib, sprang von der Matratze aus tausend Nägeln hoch und riss das Dachfenster auf. Die Nacht war schwarz im alles verschlingenden Ozean, zehntausend Meter tief.
Leuchtend zitternde Sterne erschienen wie eine Bedrohung. Ritter der Finsternis in bleischweren Rüstungen auf schwarzen Hengsten überrannten mich wie einen Grashalm auf der Wiese.
Feuchte Morgenluft und ein Windhauch vom nahen Mischwald retteten mich aus dem Albtraum. Hin in die kräftigen Arme der nackten Vorboten des aufziehenden Herbstes. Alles wird gut! flüsterte eine Stimme aus dem Nichts und fing mich auf wie einen erschöpften Ritter nach blutgetränkter Schlacht.
Alles verschwor sich gegen mich! Nichts lief normal, geschweige denn gut. Oder? Nichts. Nicht mal das Notebook funktionierte richtig. Jede technische Unebenheit brachte mich dem Wutanfall ein Stück näher. Ich vertippte mich in jeder Zeile zehn Mal, weil ich einfach nicht bei der Sache war. Die Zuversicht wurde gekillt. Hinterrücks. Aber nicht unvorbereitet. Als professioneller Träumer glaubte ich immer, es würde schon irgendwie weitergehen. Dabei gab es nicht einen Zipfel Hoffnung auf Besserung. Kein Zweifel. Keine Zukunft.
Die Einsamkeit zermürbte mich. Keine Ahnung, wie ich diese Zeit überstand.
Welcome to New York City
Der dicke, schwarze Mann mit dem Bauch eines deutschen Biertrinkers erlöste mich. Er gab eine der drei besetzten Duschen frei. Ich ließ mir das kalte Wasser über die verschwitzten Haare und die klebrige Haut laufen.
Ich war in New York. 34. Straße, YMCA, 10. Stock. Zusammen mit meiner Frau Rosa belegte ich ein bescheidenes Zimmer. Mit Etagenbetten. Gemeinschaftsduschen im Flur. Hauptsache angekommen.
Nachts um vier Uhr aufgestanden. In einem kleinen Ort zwischen München und den Bergen. Vier Stunden Autofahrt nach Frankfurt am Main. Acht Stunden Charterflug. 45 Minuten Wartezeit am Gepäckband vom John F. Kennedy Airport. Anderthalb Stunden Bus- und Bahnfahrt bis ins Hotel.
New York, the Big Apple.
Hier vereint sich alles und nichts.
Mit den beiden extrem unterschiedlichen Seiten eines Apfels: Von der einen, uns abgewandten Seite fängt er an zu faulen; während er auf der anderen rot und knackig zum Reinbeißen verführt.
New York, die Regenbogenstadt. Deren Farben einerseits schillernd und kraftvoll vom Himmel in die Herzen der Menschen schießen, den immer währenden Aufbruch symbolisierend; andererseits wirken sie matt und zeugen von Erschöpfung und Kraftlosigkeit.
New York, der Schmelztiegel. In dem die Rassen nicht verschmelzen, wie den Touristen suggeriert wird, sondern für sich leben. Ob in Little Italy, Chinatown oder Harlem.
New York, ein urbanes Universalgenie. Mit hohen Tiefen und tiefen Höhen. Nichts ist berechenbar. Die Wolkenkratzer sind nur die Spitze eines Eisbergs in der von Hitze flirrenden Steinwüste. Egoismus verdirbt die Menschen. Jeder gegen jeden.
Auf dem Dach des World Trade Center. Damals, als die zwei Türme des weltweiten Handels, Twin Tower genannt, noch standen, kamen wir uns vor wie Himmelsboten ohne Botschaft. Herrscher ohne Volk. Dompteure von Tausendfüßlern ohne Beine. Der Griff nach den Wolken: ohne Aussicht auf Erfolg!
People watching. Sprachengewirr. Hier ein Foto, da ein Anhängsel. Erinnerungen. New York von oben gesehen. Herabgesehen. Alles klein und nichtig. Die Wolkenkratzer wirkten im Schatten der Wolken matt wie Rohdiamanten, deren Glanz erst Minuten später im Schliff der warmen Junisonne leuchtete.
Ein schwindelerregendes Auf und Ab wie an der Börse der Wall Street, gleich um die Ecke.
Ein Gedanke erreichte mich unterm Himmelszelt wie ein Blitz: Wann nimmt uns der Hurrikan hier oben auf dem Dach der 107. Etage endlich mit in den East River, der da unten wie eine hungrige Python ruhelos vorbeischleicht? Der scharfe Wind pfeift immer noch durch unser Haar und zerrt an unseren Klamotten, während er schon geduldig Ausschau nach reiferen Menschen mit entschlossenerer Todessehnsucht hält.
Oder wollte der stürmische Geschichtenerzähler uns und die Welt vor jenem Unglück warnen, das Jahre später diese außergewöhnlichen Bauwerke der Neuzeit mit Hilfe zweier Flugzeuge dem Erdboden gleichmachen sollte?Fremde schlendern in luftiger Höhe mit erhobenem Kopf, durchgedrückter Brust und schwerem Fotoapparat um den Hals an der weltberühmten Silhouette New Yorks vorbei. Als wären sie die Gastgeber dieser großartigen Kulisse, die ihnen zu Füßen liegt. Für diesen Augenblick vergaßen Hunderte von Touristen die Wunden ihres Alltags.
Und wir? Vom Aussichtsturm des World Trade Center mutiert ein Menschenleben zum Staubkörnchen. Das ist Leben in New York City.
Schreck auf der 8. Avenue
Ein Bus der Linie M 10 brachte uns auf der 8. Avenue nach Uptown Harlem. Von einer Sekunde auf die andere durchfuhr ein Schreck unsere Glieder. Wir begriffen, dass wir nur noch die einzigen Weißen in diesem getönten, vollklimatisierten Linienbus waren, nachdem der weiße gegen einen schwarzen Fahrer ausgetauscht wurde.
Mit uns fuhr Bernd, ein in Riad arbeitender Elektroingenieur aus Berlin, der eine Woche in New York verbrachte. Davon anderthalb Tage mit uns.
Die Häuserreihe glich zunehmend einer ausgebrannten Ruinenlandschaft. In einem tristen Backsteinwohnblock waren mehr als die Hälfte der Fenster zugemauert. Eine beklemmende Schattenwelt unserer gespenstischen Busfahrt. Vor den verkommenen Hauseingängen lungerten Frauen und Männer herum; die einen dick und aufgeschwemmt, die anderen dünn und ausgezehrt. Ihre leeren Blicke verloren sich in einer schwermütigen Trostlosigkeit der Höhen und Tiefen. Im Nichts. Vor allem junge Männer in arbeitsfähigem Alter suchten vergeblich ihre Zukunft auf dieser Avenue des Drecks. Die hatten den Mut verloren und die Kraft verschlissen, Harlem wenigstens für ein paar Stunden zu entfliehen. Für einen kleinen Hoffnungsschimmer auf einen Aushilfsjob als Tellerwäscher. Der vage Beginn eines Traums von arbeitslosen schwarzen Bürgern in einer von weißen Managern beherrschten reichen Weltstadt.
Ihre Euphorie zerplatzte schon im nächsten Augenblick. Ausnahmefälle gab es nicht. Auch nicht den Tellerwäscher, der es zum Millionär schaffte. Leerstehende Häuser sind ihre Heimat. Eine andere haben sie nicht, zwischen Hudson und East River.
Sie prügeln sich um einen Bissen vom letzten Abfall des Hamburgers, den die Reichen ihnen mit abfälliger Handbewegung auf die Bordsteinkante warfen. Ohne sie eines Blickes zu würdigen. Zeitlos.